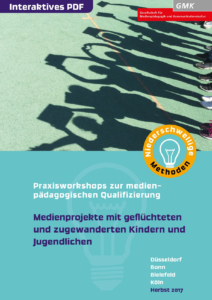Broschüren
 Lauter Hass – leiser Rückzug
Lauter Hass – leiser Rückzug
Wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht
Ergebnisse einer repräsentativen Befragung
- Studie abrufbar unter: https://kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de/lauter-hass-leiser-rueckzug/
- Studie in geringer Stückzahl bestellbar unter: gegenhin@gmk-net.de
Das Internet ist der wichtigste öffentliche Debattenraum unserer Zeit. Doch das digitale Miteinander gerät zunehmend unter Druck. Viele ziehen sich angesichts von Beleidigungen, Mord- oder Vergewaltigungsandrohungen aus dem öffentlichen Diskurs im Netz zurück. Das ist gerade jetzt besorgniserregend: In diesem Jahr finden die Wahlen zum Europäischen Parlament sowie Landtags- und Kommunalwahlen in mehreren deutschen Bundesländern statt. Vor allem Rechtsextreme mobilisieren massiv in den sozialen Netzwerken und verbreiten Hass und Desinformation.
Die von Das NETTZ, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und den Neuen deutschen Medienmacher*innen im Rahmen des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz durchgeführte repräsentative Studie zeigt, dass Hass im Netz alltäglich ist und weiter zunimmt. Es besteht dringender Handlungsbedarf, wenn wir unsere Demokratie vor dieser Entwicklung schützen wollen.
Diese neue Studie ist die seit 2019 umfangreichste Erhebung zu Wahrnehmung, Betroffenheit und Folgen von Hass im Netz in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen:
- Hass im Netz kann alle treffen. Aber nicht alle gleich. Fast jede zweite Person (49 %) wurde schon einmal online beleidigt. Ein Viertel (25 %) der Befragten wurde mit körperlicher Gewalt und 13% mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Besonders häufig betroffen sind nach eigenen Angaben Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund (30 %), junge Frauen (30 %), und Menschen mit homosexueller (28 %) oder bisexueller (36 %) Orientierung. Fast jede zweite junge Frau (42 %) erhielt bereits ungefragt ein Nacktfoto.
- Hass im Netz führt zum Rückzug aus demokratischen Diskursen. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung (57 %), beteiligt sich seltener an Diskussionen (55 %) und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger (53 %). 82 % der Befragten fürchten, dass Hass im Netz die Vielfalt im Internet gefährdet. Mehr als drei Viertel (76 %) sind besorgt, dass durch Hass im Netz auch die Gewalt im Alltag zunimmt. Der Großteil (89 %) stimmt zu, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat.
- Plattformen müssen Verantwortung für Hass im Netz tragen. 86 % der Befragten finden, dass Social-Media-Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen. 79 % stimmen der Aussage zu, dass diese Plattformen auch finanzielle Verantwortung für die durch Hass im Netz entstehenden gesellschaftlichen Schäden tragen sollten.
Über die Studie
Die Studie „Lauter Hass – leiser Rückzug“ wurde 2023 von den zivilgesellschaftlichen Organisationen Das NETTZ, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und den Neuen deutschen Medienmacher*innen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz in Auftrag gegeben. Ziel der Erhebung ist es, einen aktuellen Stand zu Hass im Netz für Deutschland abzubilden. Damit liegen erstmals seit der Studie des IDZ 2019 repräsentative empirische Daten in ähnlichem Umfang und Detailgrad vor. Befragt wurden mehr als 3.000 Internetnutzer*innen in Deutschland ab 16 Jahren.
Herausgeber*innen:
Das NETTZ, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid, Neue Deutsche Medienmacher*innen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz
Wissenschaftliche Umsetzung: pollytix strategic research GmbH (Vorerhebung: Bilendi GmbH)
Erhebungszeitraum: Oktober-November 2023 (Vorerhebung: Juli-August 2023)
Alle Informationen zur Studie: https://kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de/lauter-hass-leiser-rueckzug
Tipps für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“
Herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit
Aktualisierte Neuauflage 2019
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Herausgeber) hat in Zusammenarbeit mit der GMK (Konzept und Texte) einen Elternratgeber für den bewussten Umgang mit Medien in der Familie entwickelt. Die kostenlos zu beziehende Elternbroschüre wurde durch ein GMK-Team erweitert und aktualisiert. Das Material bietet Fallbeispiele aus dem Medienerziehungs-Alltag, Hintergrund-Infos zur medialen Wahrnehmung von Kindern verschiedener Altersstufen, Tipps für verschiedene Altersgruppen und zum Umgang mit verschiedenen Medien.
Broschüre als PDF | Bestellung unter: www.bzga.de
Inhalt:
Digitale Technologien verändern unser Zusammenleben: Computer, Tablets, Konsolen oder mobile Spielgeräte sind heute in den meisten Familien präsent und werden auch gern von Kindern genutzt. Sie sind Teil unseres Alltags und spielen bereits im Leben von jüngeren Kindern eine wichtige Rolle.
Manchmal bemerkt man gar nicht mehr, wie sich nützliches „Spiel-Zeug“ in alltägliches Handeln eingemischt hat. Dies gilt besonders für das mobile Universal-Medium Smartphone. Es hat im vergangenen Jahrzehnt Spiel-Räume, -Zeiten und -Regeln des Alltagslebens mehr und mehr beeinflusst. Die Vielzahl, der rasche Wandel und das Zusammenwachsen von technischen Medien aller Art bringen in Sachen Medienerziehung für Familie, Kindergarten, Hort und Grundschule ständig neue Herausforderungen mit sich. Besonders Familien fällt es heute nicht immer leicht, sich in dem oft schwer durchschaubaren Medien-Netzwerk aus Computer, Tablets, Konsolen oder mobilen Spielgeräten, Fernsehen, Streaming oder Videoclips gut zurechtzufinden. Die Herausforderung dabei: Die Vor- und Nachteile der Mediennutzung kritisch wahrzunehmen und auf Probleme angemessen zu reagieren, die Mediengebrauch im alltäglichen Zusammenleben mit sich bringen kann.
Deshalb will diese Broschüre Wege zu einer sinnvollen Medienverwendung in der Familie aufzeigen. Fallbeispiele aus dem Familienalltag zeigen dabei auch, wie sich schwierige Medien-Situationen bearbeiten lassen.
Aus dem Inhalt:
- Unser Check-Up in Sachen Medien und Familie
- Wie Familien ihren Umgang mit Medien regeln
- Was Eltern wissen müssen: Kinder nehmen Medien anders wahr
- Tipps zu einzelnen Medien
- Fernsehen, Streaming, Videoclips
- Smartphone, Tablet, Computer, Konsole – Kinder digital vernetzt und unterwegs
- Hörmedien und Sprachassistenten
- Kinder im Medienverbund
- Werbung
- Persönlichkeits- und Urheberrechte, Datensparsamkeit, Smarthome
- Achtung Medien! Medien – mit Vorsicht genießen!
- Zusammengefasst – Empfehlungen zum Umgang mit Medien in der Familie
- Anknüpfen, vertiefen, nachfragen: Weiterführende Informationen
Wissen Sie, welche Videos Ihr Kind im Internet veröffentlicht?
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe veröffentlicht Handlungsempfehlungen zum Kinder-Influencing
Kinder-Influencer*innen sind immer häufiger auf sozialen Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram unterwegs. Sie präsentieren sich und ihren Alltag einer großen Menge an Menschen – häufig völlig unreflektiert im Hinblick darauf, welche Informationen sie von sich preisgeben. Aber auch wenn Eltern bei Instagram ein Bild mit ihrem Kind posten oder bei YouTube ein gemeinsames Video veröffentlichen, werden Kinder bereits in jungem Alter zu Akteur*innen im Netz.
Um Kinder vor Gefahren zu schützen und ihre Rechte zu wahren, hat die „Arbeitsgruppe Kinder-Influencing“, die aus sieben interdisziplinären Institutionen der Handlungsfelder Medienpädagogik, Jugendmedienschutz und Kindermedien besteht und von Media Smart e.V. koordiniert wird, umfangreiche Handlungsempfehlungen entwickelt. Diese sollen es Eltern erleichtern, ihre Kinder im Netz zu begleiten und ihnen einen reflektierten und sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken zu ermöglichen.
GMK-Geschäftsführerin Dr. Friederike von Gross betont: „Die gemeinsam entwickelten Handlungsempfehlungen zum Kinder-Influencing bieten Orientierung für Eltern, Pädagog*innen, Agenturen und Werbetreibende. Es ist wichtig, dass Kinder das Internet kreativ und interessengeleitet, aber auch sorgenfrei nutzen und mitgestalten können. Content sollten sie informiert und ohne Druck produzieren dürfen. Erwachsene müssen vor allem Jüngere dabei verantwortungsbewusst begleiten und dabei stets zum Wohle des Kindes agieren. Der Leitfaden bietet ihnen diesbezüglich wichtiges Hintergrundwissen, rechtliche Rahmenbedingungen, eine Checkliste sowie ein nützliches Glossar.“
Das Dokument steht hier und unter www.mediasmart.de/kinder-influencing zum Download bereit.
Die Arbeitsgruppe „Kinder-Influencing“ besteht aus Media Smart e.V., der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM), der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK), jugendschutz.net, der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) und SUPER RTL.
Kontakt:
GMK-Geschäftsstelle
Obernstr. 24a
33602 Bielefeld
E-Mail: gmk@medienpaed.de
Downloads:
 Seminare und Methoden
Seminare und Methoden
Herausgegeben von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
Materialien zur aktiven Medienarbeit, Sprachförderung, Verbraucherschutz | Zum Einsatz in Integrationskursen
Broschüre als PDF
Inhalt:
Methoden und Seminare für Mitarbeiter*innen in Integrationskursen oder in der Zusammenarbeit mit jungen Erwachsenen mit Flucht- oder Migrationshintergrund
Digitale Medien und die praktische Medienarbeit können auf vielfältige Art und Weise einen enormen Beitrag für die Integration leisten: Bei der gesellschaftlichen Teilhabe, beim Einstieg in das Ausbildungs- oder Berufsleben. Sie können deutsche Sprachkenntnisse erweitern und Orientierung im neuen Lebensumfeld bieten. Auch zentrale Kenntnisse im Jugend-, Verbraucher- und Datenschutz spielen zunehmend eine wichtigere Rolle bei der Mediennutzung und gehören zur Medienarbeit dazu. Mit dem Projekt wird genau an dieser Stelle angesetzt. „Medienpädagogik der Vielfalt“ bietet niederschwellige Methoden und Fortbildungen zur Unterstützung an.
Ziele des Projektes:
- Sprachförderung durch kreative Medienarbeit
- Ausbau der eigenen medienkritischen Haltung
- Niederschwellige Methoden zum Einsatz von Medien bereitstellen und vermitteln
- kulturdiverse Medienpädagogik
- Umgang mit Fake News
- Informationen zu Verbraucherschutz und kostenfreien Apps
- Auseinandersetzung mit Datenschutz und Privatsphäre
- Qualifizierung von Mitarbeiter*innen
- Einführungen in Technik
Die für das Projekt entwickelten Materialien bestehen aus praktischen niederschwelligen Methoden, die visuell unterstützt aufbereitet sind. Alle Methoden sind auch online unter medien-und-vielfalt.gmk-net.de zu finden. Die Materialien stehen unter der CC-by-Sa 4.0 Lizenz zur Verfügung. Sie dürfen das Material bearbeiten und teilen, unter der Bedingung der Namensnennung und der Weitergabe unter der gleichen CC-Lizenz.
 Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des gamescom Congress
Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des gamescom Congress
Herausgegeben von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
Als Lehrkraft muss man nicht automatisch Gaming-Expert*in sein. Stattdessen gilt es, die Kompetenzen und Erfahrungen der Schüler*innen gewinnbringend, produktiv und autonom zu nutzen. Das Potential von Videospielen kann so zu einem bereits im Lehrplan vorgesehenen Thema genutzt werden und Motivationsbarrieren aufbrechen. Beispiele dazu finden Sie in diesem Methoden Handout.
Broschüre als PDF
Inhalt:
Schule und Games – Wie passt das zusammen?
Digitale Medien dienen mit steigender Wichtigkeit als Einsatzmittel im Lernprozess für Heranwachsende. Auch die Montessori Pädagogik hat gezeigt: Spielerische und kreative Lernansätze fördern durch das intensive Auseinandersetzen mit dem Material und das Ansprechen verschiedenster Sinne den Lernprozess.
Die kreative und kritische Auseinandersetzung mit digitalen Medien fördert unter anderem Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Analyse- und Problemlösefähigkeit. Der Medienkompetenzrahmen NRW sieht in diesen und vielen weiteren relevanten Bereichen einen Erwerb von entsprechenden Fähigkeiten vor. Pädagogische Lernsoftware, im Sinne von „Game Based Learning“, existieren vielfältig, jedoch bedarf es entsprechender Techniken und ggf. die Einarbeitung der Fachkräfte und Schüler*innen in die Mechaniken des Spiels.
Eine Alternative zur Arbeit mit spezieller Lernsoftware stellt das sogenannte „Game Inspired Learning“ dar. Prof. Dr. Christoph Klimmt von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover stellte auf dem gamescom congress 2018 diesen praktisch-orientierten Ansatz vor: Games adressieren Lebenswelt-Themen und Interessen von Kindern und Jugendlichen, gerade deshalb sind sie so attraktiv für die Arbeit mit dieser Zielgruppe. Beim „Games Inspired Learning“ werden Spiele eingesetzt, die nicht primär „Lernspiele“ sind, sondern welche die Lebenswelten und Interessen von Kindern und Jugendlichen ansprechen. Auch für die pädagogische und schulische Arbeit und im Hinblick auf Lernprozesse von Heranwachsenden zeigen solche Games ihre Stärken und können wertvoll im Unterricht eingesetzt werden, wenn ein didaktisches Konzept zugrunde liegt.
Weitere Infos zu “Schule und Games” – Fortbildungsangebot für Lehrer*innen im Rahmen des gamescom congresses am 22.08.2018 finden Sie hier.
 Ein Projektbuch für pädagogische Fachkräfte
Ein Projektbuch für pädagogische Fachkräfte
Herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln
Konzept: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
Informationen und Anregungen zur inklusiven Medienbildung in der Schule, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Praxisbeispiele für pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte
Broschüre als PDF | Kostenlose Bestellung unter: www.bzga.de
Inhalt:
Internetrecherchen, Freundschaften pflegen, fremde Orte finden, Momente des Alltags festhalten oder die Nachrichten verfolgen – das alles geschieht heute ganz selbstverständlich mit der Unterstützung von digitalen Medien. Inklusive Medienbildung will allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung im Umgang mit technischen Medien der Kommunikation und Interaktion ermöglichen. Vor allem der Schule stellen sich enorme Herausforderungen, wenn es darum geht, dass alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam und gleichberechtigt an denselben Inhalten lernen können und, dass es jeder und jedem Lernenden – ob mit oder ohne Behinderung – ermöglicht wird, seine persönlichen Potenziale und Begabungen optimal zu entwickeln, Wertschätzung und Zugehörigkeit zu erleben und aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben.
Durch gezielte Medienerfahrungen lernen Kinder und Jugendliche, sowohl als einzelne als auch in Gruppen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrzunehmen und zu verwirklichen. Sie lernen auch, wie sie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. Inklusive Medienbildung kann dadurch zur Förderung seelischer, sozialer und körperlicher Gesundheit im Sinne eines umfassenden Wohlbefindens beitragen.
Im Projektbuch werden Grundlagen einer inklusiven Medienbildung aufgegriffen. Um die theoretischen Ansätze zu konkretisieren werden exemplarische Projekte inklusiver Medienbildung und -arbeit aus verschiedenen Bundesländern vorgestellt:
- Theorie und Praxis einer inklusiven Medienbildung
- Projekte inklusiver Medienbildung und -arbeit
- Projekte im Handlungsfeld Schule
– Medienbildung und Inklusion – Praxisbeispiel Schüler*innen- und Kiezzeitung „Hallo Marianne!“
– Morgenmuffel Radio – das Schulradio an der Grundschule Heiligenhaus
– Die Radio-AG der Schule am Marsbruch – Aktive Radioarbeit mit Kindern und Jugendlichen - Projekte in Kooperationszusammenhängen
– Weil es normal ist, verschieden zu sein – „ganz schön anders“ ein Kurzfilmwettbewerb wirbt für Inklusion und Teilhabe
– Durchblick im Netz, ein inklusives, medienpädagogisches Projekt zur risikoarmen Teilhabe an Jugendmedienkultur und weitere
Zusammen mit den Broschüren „Gut hinsehen und zuhören!“ – Tipps für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“ , dem gleichnamigen Ratgeber für pädagogische Fachkräfte, den Unterrichtsmaterialien zum Thema Fernsehen oder den Heften 25, 27 und 28 der Grundschulreihe gesund und munter, bildet das Projektbuch mit den Fachheften „Anregung statt Aufregung“ und „Werkstattbuch Medienerziehung“ ein umfangreiches Informations- und Arbeitsangebot zur Förderung der Medienkompetenz in Familie, Kindergarten, Hort und Grundschule.
Qualifizierungskonzept zum Mediencoach & Praxisleitfaden für die medienpädagogische Arbeit mit Patientinnen und Patienten
Anna-Maria Kamin/Dorothee M. Meister/Nele Sonnenschein/Lara Gerhardts
Projektbeteiligte: Universität Paderborn, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL); Paderborn 2018
Das Medienkonzept für den Maßregelvollzug konnte auf Grundlage der im Projekt „Netzkompetenz für Patientinnen und Patienten“ gewonnen Erfahrungen praxisnah entwickelt werden. Es umfasst sowohl Hinweise zur Qualifizierung von Mediencoaches als auch den Transfer zur praktischen Umsetzung medienpädagogischerArbeit.
Broschüre als PDF
Praxisworkshops zur medienpädagogischen Qualifizierung
Medienprojekte mit geflüchteten und zugewanderten Kindern und Jugendlichen
Ein Projekt der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
Gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Welche einfach umsetzbaren Methoden eignen sich für die Arbeit mit neu Zugewanderten? Als ein Ergebnis der Qualifizierungsworkshops, welche die GMK mit Förderung der Landesregierung NRW im Herbst 2017 durchgeführt hat (hier nachlesbar), wurden bewährte und gut umzusetzende Methoden aus allen vier Seminaren zusammengestellt. Das interaktive PDF informiert auch, inwiefern sich diese Methoden für bestimmte Bedarfe in der Zusammenarbeit mit neu Zugewanderten und Geflüchteten eignen. Die Qualifizierungsseminare, die neben den niederschwelligen Methoden weitreichende Projekte vorstellten, wurden von vier Einrichtungen aus NRW durchgeführt: jfc medienzentrum Köln, ProMädchen Düsseldorf, FiBB Bonn und JUMP Bielefeld.
Broschüre als PDF
 Neue Wege zur Förderung von Medienkompetenz in Familien
Neue Wege zur Förderung von Medienkompetenz in Familien
Herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit
Das Fachheft bündelt Informationen zu drängenden Themen der Medienerziehung und Medienpädagogik. Es greift die aktuelle Mediendiskussion auf und erläutert Wege, wie pädagogische Fachkräfte in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern die Medienkompetenz von Familien fördern können.
Broschüre als PDF | Bestellung unter: www.bzga.de
Inhalt:
Technische Medien aller Art sind aus dem heutigen Alltagsleben von Familien nicht mehr wegzudenken. Wie selbstverständlich scheinen Fernsehen, Video, Computer und Internet, Radio, CD-Player, das Mobiltelefon oder Spielekonsolen in unser Leben hineinzuspielen. Doch welcher Umgang mit welchen Medien ist sinnvoll? Bereits Grundschulkinder nutzen heute schon Medien aller Art. Kinder haben aber noch nicht die Fähigkeit, sich mit verschiedenen Medienangeboten und -inhalten differenziert auseinander zu setzen. Und wenn ihre Lebenswelt eher entwicklungshemmend als entwicklungsfördernd ist, dann ist nicht selten mit negativen Folgen des Medienkonsums zu rechnen. Die möglichen Gründe dafür herauszufinden, zu untersuchen und zu klären, ist eine komplexe Aufgabe, die sich Eltern, Kindern und pädagogischen Fachkräften gleichermaßen stellt. Die Beiträge in dem vorliegenden Band zeigen auf, wie diese schwierige medienpädagogische Arbeit bewältigt werden kann.
Das Fachheft „Anregung statt Aufregung“ bündelt Informationen zu drängenden Themen der Medienerziehung und Medienpädagogik. Es greift die aktuelle Mediendiskussion auf und erläutert Wege, wie pädagogische Fachkräfte in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern die Medienkompetenz von Familien fördern können. Im Einzelnen wird aufgezeigt:
- wie im Rahmen schulischer und außerschulischer Elternarbeit der Umgang mit Fernsehen, Computerspiel, Handy, sozialen Netzwerken im Internet oder auch Werbung aufgenommen werden kann,
- welche Rolle die verschiedenen Medien im Miteinander der Familienmitglieder spielen und was das für die Medienerziehung in Familien bedeutet und
- welche medienbezogenen Aufgaben in Zukunft auf Familien zukommen werden.
Das Fachheft umreißt zudem den rechtlichen Rahmen für eine gefahrlose Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche.
Zusammenarbeit mit Eltern – in Theorie und Praxis
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.)
Im Rahmen einer Fachtagung im Jahr 2013 haben zahlreiche Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medienpädagogik, und Bildungsarbeit darüber diskutiert, wie eine gelingende Elternarbeit im Kontext der Medienerziehung gestaltet werden kann. Auf der Grundlage dieser Veranstaltung versammelt der Reader nun interessante Beiträge aus Theorie und Praxis, die vielfältige Erfahrungen aufzeigen, oftmals zum Nachdenken anregen und vor allem viele Tipps für die praktische Arbeit mit Eltern geben.
Broschüre als PDF | Bestellung unter: www.bzga.de
Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung: Erziehung heißt auch Medienerziehung
2. Theorie-Ansätze zur Förderung der Medienerziehung in der Familie
- Bernward Hoffmann: Welche Medien sind gesund und wenn ja wie viele? Gesundheitsförderung und Medienbildung in Berufsfeldern der Gesundheit und der Sozialen Arbeit
- Claudia Lampert/Marcel Rechlitz: „In der Theorie ist das natürlich immer super einfach, aber in der Praxis …“ – Anforderungen an und Ansatzpunkte für eine gelingende Medienerziehung in der Familie
- Gudrun Marci-Boehncke: Gemeinsam verantworten – gemeinsam gestalten: Medienerziehung in Bildungsnetzwerken
- Mona Kheir El Din: Der vorurteilsbewusste Ansatz in der medienpädagogischen Elternarbeit
- Sandra Fleischer/Peter Kroker: Medien in der frühen Kindheit – Medienerziehung immer und überall
- Rudolf Kammerl: Intensive und exzessive Internetnutzung in Familien
3. Methoden und Konzepte der praktischen Elternarbeit
- Anja Pielsticker/Renate Röllecke: Eltern direkt erreichen – Zusammenarbeit mit Eltern gestalten
- Markus Schega/Wolfgang Schill: Wie die medienpädagogische Zusammenarbeit mit Eltern in der Schule gelingen kann – Beispiel Grundschule
- Matthias Felling: „Gib mir mal das Tablet, Mama“ – Familienalltag mit mobilen Medien
- Sabine Eder/Carola Michaelis: Methodenpool und Materialien zur Elternarbeit
- Kristin Langer: Was Eltern in Fragen der Medienerziehung dringend wissen möchten … und auch zu fragen gewagt haben
Ratgeber für pädagogische Fachkräfte
Herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit
Neben dem Elternratgeber gibt es die gleichnamige Broschüre für pädagogische Fachkräfte in der (außer-)schulischen Jugendarbeit mit praxisnahen Handlungsvorschlägen für die medienbezogene Arbeit mit Eltern und Familien.
Broschüre als PDF | Bestellung unter: www.bzga.de
Inhalt:
Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur das Fernsehen als Medium Nr. 1, sondern auch andere technische Medien – wie zum Beispiel Computer, Internet oder Mobilfunk – immer mehr in unser aller Leben hineinspielen. Die heutige Medienwelt ist sehr vielfältig, oft kaum noch durchschaubar und wandelt sich auch sehr rasch. Dies bringt nicht nur für die Medienerziehung in Familien zum Teil völlig neue Probleme und Herausforderungen mit sich, sondern gleichermaßen auch für die Medienerziehung in Kindergarten, Hort und Grundschule. Damit sich pädagogische Fachkräfte bei ihrer medienbezogenen Arbeit mit Eltern und Familien sinnvoll mit dieser Situation auseinander setzen können, wurden in dieser Handreichung eine Fülle von Informationen, Anregungen, Hinweisen und auch Regeln zu einem „Ratgeber“ zusammengestellt. Aus medienpädagogischer Sicht will dieser Ratgeber vor allem Orientierungs- und Handlungshilfen dazu bieten, wie sich Medien aller Art von Eltern überlegt, verantwortungsvoll und „gekonnt“ in das alltägliche Familienleben einbeziehen lassen.
Fallbeispiele aus dem „echten“ Familienleben regen dazu an, gemeinsam mit Eltern einen guten Weg für den Umgang mit Medien in der Familie zu finden. Dabei soll auch verständlich gemacht werden, was die Mediennutzung für Kinder bedeuten kann und weshalb sich Kinder oftmals von bestimmten Medieninhalten faszinieren lassen. Weiterhin wird an einfachen Beispielen gezeigt, wie Medien genutzt werden können, um in der Familie gemeinsam zu spielen, zu lernen, sich zu unterhalten und miteinander im Gespräch zu bleiben.
Der Handreichung liegen folgende Leitfragen zu Grunde:
- Wie können Medien in der Familie sinnvoll und angemessen genutzt werden?
- Wie können Eltern ihren Kindern einen kreativen, kritischen und zeitlich akzeptablen Umgang mit Medien näher bringen? Welche Regeln und Vereinbarungen helfen dabei?
- Wie gehen Kinder mit Medien um?
- Warum lieben Kinder und Jugendliche andere Sendungen, Spiele und Musik als Erwachsene?
- Sollen Familien Medien zusammen oder getrennt nutzen?
- Wie schützen Eltern ihre Kinder vor Gefahren aus dem Internet?
- Welche neuen Medientrends kommen auf uns zu?
- Wie lassen sich Medien in der Familie altersgerecht verwenden?
- Machen Medien dick, dumm und krank?
Kompaktausgabe
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (Hrsg.)
Die gekürzte GMK-Stellungnahme als Pixiebuch ist Teil des Berichts „Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche“ (herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013).
Pixiebuch als PDF
Eine Bestandsaufnahme
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.)
Medienkompetenz muss jungen Menschen beim Aufwachsen mit Medien von Anfang an vermittelt werden. Dies ist ein zentrales Ergebnis des Medienkompetenzberichts. Die Bestandsaufnahme analysiert entscheidende Handlungsfelder für die Vermittlung von Medienkompetenz und liefert damit die Grundlage, für eine noch gezieltere und bedarfsgerechtere Ausrichtung der Medienkompetenzförderung.
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich über www.bmfsfj.de
Broschüre als PDF
Tipps für Eltern von Kindergartenkindern
Das Familienministerium hat in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und mit inhaltlicher und konzeptioneller Unterstützung der GMK eine Broschüre entwickelt, die Eltern praktische Tipps und Links zur Medienerziehung von Kindergartenkindern an die Hand gibt.
Broschüre als PDF | Bestellung (auch in russischer und türkischer Sprache) unter: www.mkffi.nrw
Informationen, Anregungen und Tipps zum Umgang mit dem Fernsehen in der Familie
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend (Hrsg.)
Was macht eigentlich die kindliche Faszination an der „Flimmerkiste“ aus? Die aktualisierte Broschüre befasst sich beispielsweise mit den Fragen: Was sehen Kinder gern? Wie verarbeiten Kinder ihre Fernseherlebnisse? Wie sehen Kinder unterschiedlicher Altersstufen fern? Des Weiteren geht die Broschüre auf die Themenbereiche Werbung, Gewalt im Fernsehen und Ängste von Kindern ein.
Broschüre als PDF | Weitere Infos unter: www.bmfsfj.de